„Wenn 20 Prozent der Ressourcen für Verwaltung gebunden sind, fehlen sie genau dort, wo sie gebraucht werden – bei den Menschen.“
Einleitung
Pflegeeinrichtungen stehen unter einem doppelten Druck: steigende Personalkosten, wachsende Regulierungsanforderungen und gleichzeitig der Anspruch, wirtschaftlich zu bleiben. Die Realität: Leitungskräfte kämpfen mit Berichts- und Dokumentationspflichten, während Pflegekräfte Zeit für direkte Betreuung verlieren.
Studien zeigen, dass in stationären Einrichtungen zwischen 18 % und 26 % der Gesamtkosten auf Verwaltung, Organisation und Dokumentation entfallen – damit fließt fast jeder fünfte Euro nicht in Pflege, sondern in Formulare, Nachweise und interne Koordination.
„Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist das Werkzeug, um Komplexität zu reduzieren – nicht, um sie neu zu erzeugen.“
Der Beitrag zeigt, wie sich dieser Overhead zusammensetzt, welche Ursachen hinter der Bürokratie stehen und an welchen Punkten Digitalisierung tatsächlich strukturell entlasten kann – nicht als Softwareprojekt, sondern als Organisationsentwicklung.
Kostenstruktur und Verwaltungsanteil in der stationären Pflege
In Deutschland leben rund 820 000 Menschen in stationären Pflegeeinrichtungen. Die Gesamtausgaben für die vollstationäre Pflege betrugen 2023 über 60 Mrd. Euro. Davon entfällt der Großteil auf Personal- und Sachkosten, während Verwaltung, Dokumentation und Koordination bislang als „Nebenkosten“ geführt wurden – mit steigender Tendenz.
Mehrere aktuelle Branchenberichte, unter anderem von
Curacon GmbH (Altenhilfebarometer 2025) Curacon Altenhilfebarometer 2025
und
Solidaris Unternehmensgruppe (Betriebsvergleich 2023/24)Solidaris Betriebsvergleich 2023
zeigen übereinstimmend:
- Der Pflege- und Betreuungsdienst macht rund 65-70 % der Gesamtkosten aus.
- Unterkunft, Verpflegung und Infrastruktur liegen bei etwa 20 %.
- Der verbleibende Rest – je nach Einrichtung zwischen 10 und 25 % – entfällt auf Verwaltung, Organisation, Leitung, Abrechnung und Dokumentation.
Dieser Bereich wird zunehmend zu einem strategischen Kostentreiber. Besonders kleinere oder freigemeinnützige Träger berichten von steigendem Aufwand für Berichtspflichten, Pflegesatzverhandlungen, MD-Prüfungen und Personalplanung.
„Der Overhead wächst leise – nicht durch Ineffizienz, sondern durch Regulierungsdruck.“
Während der Verwaltungs-/Overhead-Anteil bei ambulanten Diensten im Median bei 21 % liegt (mittlere 50 %: 18-26 %) IEGUS Studie 2024 zeigt, lassen sich für stationäre Einrichtungen aktuell keine frei verfügbaren Studien mit exakt gleichem Detailgrad finden. Es ist jedoch plausibel, dass die Größenordnung vergleichbar ist – die Ausprägung unterscheidet sich durch Leitung, QM-Aufgaben und Dokumentationslast.
Wirtschaftlicher Druck durch steigende Eigenanteile
Die Eigenanteile der Bewohnerinnen und Bewohner sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Laut Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) beträgt der durchschnittliche Eigenanteil im ersten Jahr 3 108 Euro pro Monat, ein Plus von 8,3 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig liegen die Personalkosten aufgrund der Tarifangleichung auf einem historischen Höchststand.
Für Träger bedeutet das: Die Spielräume für Verwaltung, IT und Modernisierung werden kleiner – obwohl der Aufwand steigt. Genau hier setzt Digitalisierung als strukturelles Entlastungsinstrument an.
„Nicht jede digitale Lösung spart Geld. Aber jede gute Lösung spart Zeit – und Zeit ist in der Pflege die knappste Ressource.“
Ursachen der Bürokratie – warum der Verwaltungsanteil so hoch ist
Der hohe Verwaltungsanteil in stationären Pflegeeinrichtungen entsteht nicht aus Überfluss, sondern aus Systemlogik. Über die Jahre hat sich ein Geflecht aus gesetzlichen Vorgaben, Nachweispflichten und Prüfroutinen entwickelt, das den Arbeitsalltag zunehmend prägt. Während die Pflegeversicherung in den 1990er-Jahren auf Transparenz und Qualitätssicherung setzte, hat sich daraus heute ein bürokratisches System mit erheblichen Nebenkosten entwickelt.
„Niemand plant Bürokratie – sie wächst mit jeder neuen Anforderung.“
1. Regulatorik und Prüfdichte
Jede Einrichtung ist heute gleichzeitig gegenüber mehreren Instanzen rechenschaftspflichtig:
- den Pflegekassen (SGB XI)
- dem Medizinischen Dienst (MD)
- Heimaufsicht und Arbeitsschutz
- Kostenträgern und Landesbehörden
- teilweise auch gegenüber Trägerstiftungen, Kommunen oder kirchlichen Trägern.
Jede Instanz nutzt eigene Formate, Fristen und Nachweissysteme. Das führt dazu, dass ein erheblicher Teil der administrativen Zeit in Doppel- und Nachdokumentation fließt. Laut einer Erhebung des Bundesgesundheitsministeriums (BMG-Bericht zur Entbürokratisierung, 2023) verbringen Pflegefachkräfte im Schnitt 20–25 % ihrer Arbeitszeit mit Dokumentation, Berichterstellung und Nachweisen. In Einrichtungsleitungen liegt der Anteil administrativer Tätigkeiten laut einer Befragung von Curacon (2025) bei über 40 % der Arbeitszeit – Tendenz steigend. Curacon Altenhilfebarometer 2025
„Jede neue Prüfvorschrift schafft kurzfristig Transparenz, aber langfristig Reibung.“
2. Fragmentierte Softwarelandschaften
Viele Häuser nutzen parallel mehrere Systeme: Pflegedokumentation (z. B. Connext Vivendi NG), Dienstplanung, Finanzbuchhaltung, Controlling und QM-Tools. Diese Systeme sind oft nicht integriert – Daten müssen mehrfach erfasst oder manuell abgeglichen werden.
Eine Untersuchung des Instituts IEGUS (2024) zur Digitalisierung ambulanter Dienste zeigte, dass fehlende Schnittstellen zwischen Dokumentations- und Abrechnungssystemen bis zu 15 % Mehraufwand verursachen. Übertragen auf stationäre Einrichtungen ist der Effekt ähnlich, nur mit höherem Basisvolumen. IEGUS Studie 2024
„Wer Daten doppelt erfasst, digitalisiert nicht – er kopiert Papier.“
3. Personalmangel und Kompetenzdruck
Verwaltung wächst auch, weil Verantwortung steigt. Pflegefachkräfte übernehmen zunehmend Aufgaben, die früher in Verwaltung oder Leitung lagen: Nachweise, Qualitätssicherung, Planungs- und Kommunikationsaufgaben. Gleichzeitig werden immer weniger Fachkräfte für administrative Rollen eingestellt, da diese nicht refinanziert werden.
Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (Pflegeberufebericht 2024) fehlen bundesweit rund 50 000 qualifizierte Pflegefachkräfte, in einzelnen Bundesländern bis zu 10 % des Soll-Personals. Diese Lücke führt dazu, dass Dokumentations- und Planungsprozesse auf die Schultern der Pflegekräfte verlagert werden – also dorthin, wo sie am meisten Zeit kosten.
„Der Mangel an Pflegepersonal erzeugt Bürokratie, weil Verantwortung nach unten durchgereicht wird.“
4. Nachweisorientierte Qualitätslogik
Die heutige Qualitätslogik beruht auf Kontrolle statt auf Vertrauen. Pflegequalität wird überwiegend über Dokumentations- und Prüf-Indikatoren definiert. Das hat den Nebeneffekt, dass „Pflege“ nur dann als geleistet gilt, wenn sie dokumentiert ist.
So entsteht ein paradoxer Aufwand: Je intensiver der Qualitätsanspruch, desto mehr Nachweise müssen geführt werden – ohne dass sich die reale Pflegezeit erhöht. Der MD-Bund schreibt in seinem Bericht 2024, dass Dokumentationsmängel in 68 % der Prüfungen festgestellt wurden, während die tatsächliche Pflegequalität nur in 12 % der Fälle beanstandet wurde. Das zeigt: Fehler liegen selten in der Pflege, sondern in der Dokumentation der Pflege. MD Bund Qualitätsbericht 2024
5. Unterschiedliche Finanzierungsstrukturen
Anders als im Akut- oder Reha-Bereich sind Verwaltungsleistungen in der Pflege nicht separat refinanziert. Pflegesatzverhandlungen konzentrieren sich auf Personalkosten, Sachkosten und Investitionen – Verwaltung bleibt „Restgröße“. Der betriebswirtschaftliche Zwang, Verwaltung zu deckeln, führt paradoxerweise dazu, dass sie ineffizient bleibt: es wird nicht in Prozess- oder IT-Optimierung investiert, weil diese Kosten nicht umlagefähig sind. Solidaris (2024) zeigt, dass IT-Investitionen in stationären Pflegeeinrichtungen unter 1 % des Gesamtbudgets liegen – während die Prozesskosten für Dokumentation und Abrechnung ein Vielfaches betragen. Solidaris Betriebsvergleich 2023
„Die Refinanzierung ignoriert die Verwaltung – und bezahlt damit ihre Ineffizienz.“
Der Verwaltungsaufwand in stationären Einrichtungen ist damit nicht Ergebnis individueller Fehlsteuerung, sondern Strukturprodukt eines Systems, das Qualität durch Nachweis misst, Verantwortung nach unten delegiert und technische Integration unterfinanziert. Genau hier setzt Digitalisierung an – nicht als Einsparprogramm, sondern als Bedingung für Entlastung und Versorgungsqualität.
Digitalisierung als Hebel – wo Technik tatsächlich entlastet
Digitalisierung wird in der Pflege oft als Zukunftsversprechen gehandelt, nicht als reale Entlastung. Doch mehrere empirische Untersuchungen zeigen inzwischen, dass gezielte digitale Prozessoptimierung messbare Effekte bringt – wenn sie an den richtigen Stellen ansetzt.
„Die größte Wirkung entsteht nicht durch neue Software, sondern durch den Wegfall alter Routinen.“
1. Pflegedokumentation und Sprachassistenz
Einer der größten Zeitfresser in der stationären Pflege ist die Dokumentation. Sie sichert Qualität und Transparenz, bindet aber enorme Ressourcen: Nach Zahlen des BMG (Entbürokratisierungsbericht 2023) liegt der Dokumentationsanteil am Arbeitstag bei rund 20–25 % – das entspricht etwa 90 Minuten pro Schicht.
Eine Studie der Charité Berlin in Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI, 2025) untersuchte den Einsatz eines KI-basierten Sprachassistenten zur Pflegedokumentation. Das Ergebnis:
- 27 % weniger Dokumentationszeit bei gleichbleibender Qualität,
- 15 % geringere Fehlerquote,
- und eine nachweislich höhere Zufriedenheit des Pflegepersonals. Charité-DFKI-Pilotstudie 2025
Diese Ergebnisse sind besonders relevant, weil sie auf einer realen Stationsumgebung basieren. Die Sprachassistenz wurde in den bestehenden Dokumentationsprozess (z. B. Vivendi NG) eingebunden und nicht zusätzlich eingeführt, sondern integriert – ein entscheidender Erfolgsfaktor.
2. Das SIS-Modell – Entbürokratisierung als Grundlage der Digitalisierung
Bereits 2015 wurde das Strukturmodell (SIS – Strukturiertes Informationssammlungssystem) als Ansatz zur Entbürokratisierung eingeführt. Ziel war, den Dokumentationsumfang auf die pflegefachlich relevanten Informationen zu reduzieren. Die Evaluation des Medizinischen Dienstes (MD Bund 2024) zeigt, dass das Modell inzwischen in über 50 % der Einrichtungen vollständig implementiert ist. MD Bund Qualitätsbericht 2024
Einrichtungen, die SIS eingeführt und digitalisiert haben, berichten von
- einer Reduktion der Dokumentationszeit um bis zu 30 %,
- weniger Doppeldokumentation,
- höherer Nachvollziehbarkeit im MD-Prüfprozess.
Das SIS-Modell ist damit keine Software, sondern ein methodischer Hebel, auf dem Digitalisierung erst aufbauen kann. Wo dieser Schritt fehlt, digitalisieren Einrichtungen bestehende Bürokratie – und zementieren sie.
„Wer Papierlogik digitalisiert, macht aus Formularen nur Masken.“
3. Prozessintegration und Schnittstellen
Ein Kernproblem vieler Einrichtungen bleibt die Trennung zwischen Pflegedokumentation, Dienstplanung, Abrechnung und Controlling. Hier entstehen medienbruchbedingte Kosten, die sich leicht messen lassen: Laut einer Untersuchung des IEGUS Studie 2024 verursachen fehlende Schnittstellen durchschnittlich 15 % Mehraufwand bei Datenübertragungen.
Für stationäre Einrichtungen bedeutet das konkret:
- bis zu 1,5 Vollzeitstellen pro 100 Bewohnerplätze allein für Datenabgleiche,
- ein jährlicher Zusatzaufwand im mittleren fünfstelligen Bereich.
Moderne Plattformlösungen – etwa Connext Vivendi NG, easySoft Care, oder MHP Solution Care – setzen deshalb zunehmend auf API-basierte Integration zwischen Modulen für Doku, Dienstplanung und Verwaltung. Wo diese Schnittstellen genutzt werden, sinkt der administrative Aufwand nachweislich. Ein Beispiel aus der Solidaris-Erhebung (2024) zeigt, dass digital vernetzte Häuser im Schnitt 8 % geringere Verwaltungskosten pro Bett aufweisen. Solidaris Betriebsvergleich 2023
„Schnittstellen sind keine Technikfrage – sie sind Organisationskultur in digitaler Form.“
4. Qualitätsmanagement und Auditfähigkeit
Auch im Qualitätsmanagement zeigt sich der Effekt: Ein digitales, revisionssicheres QM-System (z. B. Vivendi PDQM oder PlanOrg AuditCare) ersetzt hunderte Excel-Dateien und manuelle Checklisten. Das Bertelsmann-Institut für Gesundheitssysteme (2024) weist in seiner Studie zu Designprinzipien digitaler Pflegetechnik nach, dass
- durch automatisierte QM-Workflows Auditzeiten um 35 %,
- und manuelle Prüfaufwände um 40 % reduziert werden können. Bertelsmann Stiftung – Digitale Pflege Studie 2024
Darüber hinaus fördern solche Systeme eine lernende Organisation: Auditergebnisse, MD-Prüfberichte und interne Verbesserungen können systematisch verknüpft werden, was die Transparenz gegenüber Aufsichtsbehörden und Trägern deutlich verbessert.
5. Haltung statt Technik – Ergebnisse der FES-Policy-Review 2025
Eine aktuelle Policy-Review der Friedrich-Ebert-Stiftung (2025) fasst 28 Studien zur Digitalisierung in der Pflege zusammen. Das Fazit:
- Technologie allein erzeugt keine Zeitgewinne,
- Schulung, Prozessreife und Akzeptanz sind die eigentlichen Erfolgsfaktoren,
- digitale Kompetenz auf allen Ebenen ist Voraussetzung, nicht Nebeneffekt. Friedrich Ebert Stiftung Policy Review 2025
„Digitalisierung ist kein Projekt, sondern eine Kulturfrage.“
Zusammengefasst lässt sich festhalten:
- Der dokumentierte Zeitgewinn durch KI-Assistenz liegt bei bis zu 27 %,
- die SIS-basierte Entbürokratisierung reduziert bis zu 30 % des Dokuaufwands,
- integrierte Prozesssysteme senken Verwaltungskosten um bis zu 8 %,
- und digitales QM verkürzt Auditzeiten um ein Drittel.
Diese Befunde belegen: Digitalisierung kann Overhead real verringern, Prozesse vereinfachen und die Pflegezeit erhöhen – wenn sie als Teil der Organisationsentwicklung verstanden wird, nicht als IT-Beschaffung.
Handlungsempfehlungen – wie Einrichtungen Digitalisierung gezielt nutzen können
Digitalisierung wirkt nicht automatisch. Viele Einrichtungen haben Software eingeführt, ohne Prozesse zu verändern – und erleben dadurch keine Entlastung. Erst wenn Technologie Teil einer strukturierten Organisationsentwicklung wird, entstehen die versprochenen Effekte.
„Digitalisierung ist kein Sprint, sondern ein Pflegeprozess: beobachten, anpassen, verstetigen.“
1. Prozesse verstehen, bevor man sie digitalisiert
Der erste Schritt besteht darin, Verwaltungs- und Dokumentationsprozesse transparent zu machen. In der Praxis empfiehlt sich eine Prozessaufnahme auf Basis von Zeit- und Tätigkeitsprofilen: Wie viel Zeit verwenden Pflegekräfte auf Dokumentation, Kommunikation, Abrechnung oder Planung? Eine Analyse des BMG (2023) zeigt, dass bereits die reine Prozesssicht 15 % Effizienzpotenzial sichtbar macht – oft ohne neue Technik. BMG-Bericht Entbürokratisierung 2023
Eine einfache Methode ist das Value Stream Mapping: Jede Tätigkeit wird nach Wertbeitrag für Bewohnerinnen und Bewohner bewertet. Alles, was keine Versorgungsqualität erhöht, wird zur Digitalisierungs- oder Automatisierungskandidatin.
„Digitalisieren heißt, das Weglassen zu automatisieren – nicht das Beibehalten.“
2. Kennzahlen für Entlastung und Wirkung definieren
Digitale Projekte scheitern oft daran, dass der Erfolg nicht messbar ist. Einrichtungsträger sollten klare Kennzahlen (KPIs) für Prozess- und Pflegezeitgewinne definieren, z. B.:
| Kennzahl | Beschreibung | Zielwert |
|---|---|---|
| Dokumentationszeit je Bewohner*in/Tag | Gesamtzeit Pflege + Dokumentation | ≤ 20 % |
| Administrationsstunden je Vollkraft | Anteil an Gesamtarbeitszeit | − 10 % in 12 Monaten |
| MD-Nachforderungen pro Quartal | Indikator für Dokumentationsqualität | < 5 |
| Digitale Erfassungsquote | Anteil vollständig digital erfasster Vorgänge | ≥ 90 % |
Solche KPIs können mit bestehenden Tools (z. B. Vivendi Controlling-Modul, Power BI, QlikView) leicht abgebildet werden. Sie schaffen Transparenz und machen Fortschritte sichtbar – ein entscheidender Hebel für Akzeptanz in den Teams.
3. Entbürokratisierung vor Digitalisierung
Bevor Systeme angeschafft oder KI-Modelle getestet werden, sollte die Pflegedokumentation methodisch vereinfacht werden. Das SIS-Modell bietet hier eine verbindliche Grundlage (vgl. MD Bund 2024 . Erst wenn Strukturen und Inhalte klar sind, lohnt sich der digitale Transfer.
In der Beratungspraxis hat sich folgende Reihenfolge bewährt:
- Dokumentationsanalyse – was ist Pflicht, was Routine, was überflüssig?
- Standardisierung – gleiche Begriffe, gleiche Kategorien.
- Digitalisierung – Integration in Doku- oder KI-Systeme.
- Schulung – praxisnahe Einführung mit Shadowing.
„Jede Stunde, die in die Vereinfachung investiert wird, spart später vier in der Schulung.“
4. Change-Management verankern
Digitalisierung ist kein IT-Thema, sondern ein Veränderungsprozess. Laut der Friedrich-Ebert-Stiftung (2025) hängt der Erfolg digitaler Projekte zu über 60 % von Kommunikation, Schulung und Beteiligung ab.
Deshalb sollten Einrichtungen:
- Super-User pro Wohnbereich benennen,
- kurze, wiederkehrende Lernimpulse statt Einmal-Schulungen anbieten,
- Feedback-Schleifen mit Mitarbeitenden nach vier Wochen etablieren,
- Fehlerkultur fördern, statt Kontrolle zu verschärfen.
Diese Maßnahmen erhöhen die Nutzung digitaler Systeme nachweislich um 20–30 % (Bertelsmann-Studie 2024). Bertelsmann Stiftung – Digitale Pflege Studie 2024
„Technik scheitert selten an Software – sie scheitert an Angst.“
5. Investitionen gezielt planen
Die größten Effekte entstehen, wenn Digitalisierung strategisch priorisiert wird. Das bedeutet: nicht jede Anwendung gleichzeitig, sondern sequenziell nach Hebelwirkung.
Ein praktikabler Dreischritt:
- Doku & Planung integrieren (z. B. Vivendi NG mit Dienstplan-Modul).
- QM & Audit digitalisieren (z. B. PDQM, AuditCare).
- Abrechnung & Controlling automatisieren (Schnittstelle zur FiBu).
Laut Solidaris 2024 amortisieren sich diese Investitionen innerhalb von zwei bis drei Jahren, wenn die Implementierung prozessbegleitend erfolgt. Das liegt vor allem an reduzierten Personal- und Prüfbeschaffungszeiten.
Einrichtungen, die Digitalisierung strategisch betrachten, senken ihren Overhead mittelfristig um 15 %, ohne Personal abzubauen – durch bessere Struktur, weniger Reibung, klarere Verantwortungen.
Die Erfahrung aus über zwanzig Evaluationsprojekten in der Altenhilfe zeigt: Digitalisierung lohnt sich dort, wo sie Pflegezeit freisetzt, Prüfprozesse vereinfacht und Verwaltung entlastet. Die Kostenersparnis ist messbar, aber der eigentliche Gewinn liegt in mehr Zeit für menschliche Zuwendung – der Ressource, die im System am knappsten ist.
Fazit – weniger Overhead, mehr Haltung
Die Zahlen sind eindeutig: Zwischen 18 % und 26 % der Gesamtkosten stationärer Pflegeeinrichtungen fließen in Verwaltung, Organisation und Dokumentation. Diese Quote ist kein Ausdruck von Verschwendung, sondern das Ergebnis eines Systems, das Qualität über Nachweis definiert, Zuständigkeiten zersplittert und technologische Integration unterfinanziert.
Digitalisierung kann diesen Trend nicht allein umkehren, aber sie kann ihn umdeuten – von einem bürokratischen Muss zu einem lernenden, datenbasierten System.
„Die günstigste Digitalstrategie ist die, die man wirklich nutzt.“
Wo Einrichtungen Prozesse verstehen, Daten sinnvoll nutzen und Mitarbeitende beteiligen, sinkt der Overhead spürbar. Die empirischen Ergebnisse zeigen es deutlich:
- – 27 % Dokumentationszeit durch KI-Sprachassistenz
- – 30 % Aufwand durch das SIS-Modell
- – 8 % Verwaltungskosten durch integrierte Systeme
- – 35 % Auditzeit durch digitales Qualitätsmanagement
-
- 20–30 % Nutzungsquote durch konsequentes Change-Management
Diese Werte stammen nicht aus Visionen, sondern aus Praxisprojekten – von der Charité-Studie 2025 bis zum Bertelsmann-Report zur digitalen Pflege (2024).
Charité-DFKI-Pilotstudie 2025
Bertelsmann Stiftung – Digitale Pflege 2024
Die Lehre daraus: Digitalisierung in der Pflege ist kein Kostenfaktor, sondern ein Strukturinstrument. Sie senkt nicht nur Prozesskosten, sondern hebt Versorgungsqualität, Transparenz und Resilienz eines Systems, das unter wachsendem Druck steht.
„Je stärker die Verwaltung digital denkt, desto mehr kann die Pflege menschlich bleiben.“
Perspektive für Entscheider:innen und Berater:innen
Für Leitungskräfte und Träger bedeutet das: Digitale Projekte sollten künftig nicht als Einzelmaßnahmen, sondern als Teil einer langfristigen Pflege- und Organisationsstrategie verstanden werden. Das umfasst:
- einheitliche Datenmodelle und Schnittstellen,
- prozessorientiertes Denken statt Moduldenken,
- klare Governance-Strukturen (wer entscheidet über Standards, wer pflegt Daten),
- und ein kontinuierliches Monitoring über Kennzahlen.
Für Berater:innen eröffnet sich daraus ein klarer Auftrag: Digitalisierung ist kein Rollout von Software, sondern die Übersetzung von Sinn, Struktur und Pflegepraxis in digitale Systeme. Dazu gehört, gemeinsam mit Einrichtungen Zielbilder, Prozesslandkarten und Prioritäten zu entwickeln, bevor Technik ausgewählt wird.
„Die wichtigste Aufgabe der Beratung ist nicht, Tools zu installieren, sondern Klarheit zu schaffen.“
Wenn Einrichtungen diese Haltung verinnerlichen, können sie Verwaltungskosten senken, Personal binden und Pflege wieder als das sichtbar machen, was sie ist – eine gesellschaftliche Kernleistung, nicht eine Datenpflicht.
TL;DR – kurz zusammengefasst
Stationäre Pflegeeinrichtungen geben rund 18–26 % ihrer Ausgaben für Verwaltung, Dokumentation und Organisation aus. Digitalisierung kann diesen Anteil deutlich senken – nicht durch mehr Technik, sondern durch bessere Prozesse:
- Entbürokratisierung zuerst: Das SIS-Modell reduziert Dokumentationsaufwand um bis zu 30 %.
- KI-gestützte Doku: Sprachassistenz senkt den Zeitbedarf um 27 %.
- Integrierte Systeme: Schnittstellen sparen rund 8 % Verwaltungskosten.
- Digitales QM: Automatisierte Workflows verkürzen Audits um ein Drittel.
- Change-Management: Erfolg hängt zu 60 % von Schulung, Kommunikation und Beteiligung ab.
Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern eine strukturelle Voraussetzung für Pflegequalität. Je stärker Prozesse, Daten und Menschen zusammenspielen, desto mehr Zeit bleibt dort, wo sie gebraucht wird – bei den Pflegebedürftigen.
„Die beste digitale Lösung ist die, die Pflege wieder möglich macht.“
- Digitalisierung in der stationären Pflege – Digitale Prozesse senken Verwaltungskosten.
- Verwaltungskosten (Overhead) in der Pflege – Anteil der Gesamtausgaben.
- Pflegedokumentation – Nachweis- und Qualitätsdokumentation
- SIS-Modell (Strukturierte Informationssammlung) – Methodische Vereinfachung der Doku
- Prozessdigitalisierung – End-to-end-Digitalisierung von Dokumentation
- Entbürokratisierung – Gezielter Abbau von Doppelstrukturen




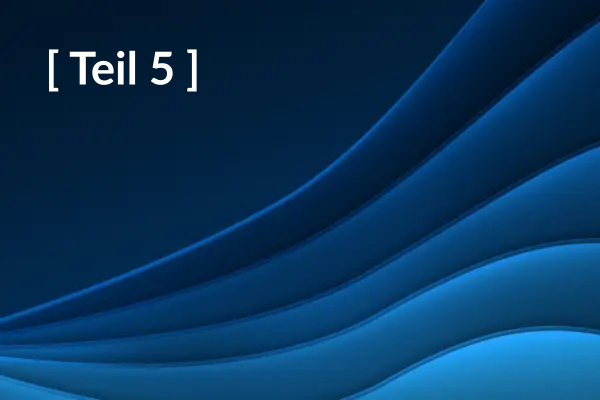
Comments