Warum Evidence-Based Management die Brücke zwischen Scrum und modernem Management ist
Viele Organisationen beschreiben sich heute als agil. Wenn man genauer hinschaut, wird jedoch deutlich: Sie arbeiten zwar in Sprints, aber sie entscheiden noch immer wie früher. Es wird viel dokumentiert, viel gesteuert, viel geliefert – aber wenig gelernt. Reviews präsentieren Ergebnisse, aber selten die Wirkung dahinter. Meetings erzeugen Aktivität, aber nicht unbedingt Erkenntnis.
Scrum ist ein guter Rahmen, um Teams handlungsfähig zu machen. Doch für echte Orientierung in der gesamten Organisation braucht es mehr als Events, Rollen und Artefakte. Es braucht ein gemeinsames Verständnis darüber, wie Entscheidungen getroffen werden und worauf es eigentlich ankommt.
Evidence-Based Management, kurz EBM, baut genau dieses Verständnis auf. Es stammt aus dem offiziellen Evidence-Based Management Guide von Scrum.org, entwickelt von denselben Autorinnen und Autoren, die auch den Scrum Guide verantworten. Der vollständige Leitfaden ist öffentlich verfügbar und bietet eine präzise Grundlage für das Modell https://scrum.org/resources/online-evidence-based-management-guide.
EBM verbindet agile Produktentwicklung mit moderner Führung und schafft eine gemeinsame Sprache für Wert, Richtung und Lernen.
1. Warum traditionelle Steuerung in komplexen Organisationen an Grenzen stößt
Viele Organisationen in Deutschland sind historisch gewachsen. Sie tragen fachliche Tiefe, Verantwortlichkeiten, Gremien und Strukturen in sich, die sich über Jahrzehnte gebildet haben. Das ist ein großer Schatz – gerade in der Sozialwirtschaft, im Ehrenamt oder in Verbänden. Gleichzeitig entsteht daraus eine Art Stabilitätslogik, die Veränderungen nur schwer zulässt.
In solchen Strukturen wird häufig so gesteuert, als ließen sich Entwicklungen präzise planen und kontrollieren. Doch digitale Transformation lebt von Unsicherheit, von Wandel und von der Fähigkeit, früh zu erkennen, ob etwas funktioniert oder nicht.
Scrum schafft dafür operative Orientierung. Aber die grundlegenden Fragen der Führung bleiben offen:
- Was bedeutet Fortschritt wirklich?
- Woran sehen wir, dass wir näher ans Ziel kommen?
- Was brauchen Teams, um schneller lernen zu können?
- Welche Entscheidungen verändern tatsächlich etwas?
EBM setzt genau hier an und erweitert den Blick.
2. Evidence-Based Management – eine Einladung zu klarer, gemeinsamer Orientierung
EBM ist kein zusätzliches Framework. Es ist ein Entscheidungsmodell, das Organisationen hilft, sich nicht über Aktivität, sondern über Wirkung zu definieren.
Ein Satz fasst den Kern gut zusammen:
„Wert entsteht dort, wo Ergebnisse bei Menschen etwas verändern.“
Damit verschiebt EBM die Perspektive. Es fragt nicht: Was wurde erledigt? Sondern: Was hat es bewirkt?
EBM lädt Führungskräfte ein, Entscheidungen nicht länger an Aufwand, Arbeitspaketen oder Plänen auszurichten, sondern an wahrnehmbaren Veränderungen. Es schafft eine gemeinsame Orientierung, gerade zwischen Management, Product Ownern, Teams und Stakeholdern.
3. Warum EBM besonders gut in deutschen Organisationen funktioniert
In vielen deutschen Organisationen – ob Verband, Träger, Verwaltung oder Unternehmen – treffen unterschiedliche Realitäten aufeinander: operative Anforderungen, politisch geprägte Entscheidungswege, föderale Strukturen, begrenzte Budgets, anspruchsvolle Stakeholder.
In diesem Umfeld hilft EBM aus drei Gründen:
- Es schafft eine Sprache, die sowohl in der Führung als auch in der Produktentwicklung verstanden wird.
- Es macht Komplexität beherrschbar, ohne sie zu vereinfachen.
- Es bietet einen Weg, Veränderung nicht als Risiko zu sehen, sondern als kontinuierlichen Entwicklungsprozess.
EBM setzt dort an, wo traditionelle Zielsysteme nicht mehr greifen. Es verbindet das Bedürfnis nach Orientierung mit der Realität dynamischer, digitaler Arbeit.
4. Die Logik von EBM in vier einfachen Perspektiven
EBM macht Wert sichtbar, indem es vier Fragen stellt:
- Wie viel Nutzen schaffen wir heute? (Current Value)
- Welches Potenzial bleibt noch ungenutzt? (Unrealized Value)
- Was hindert uns daran, besser zu werden? (Ability to Innovate)
- Wie schnell können wir lernen und liefern? (Time to Market)
Diese Perspektiven sind nicht technokratisch. Sie schaffen Klarheit darüber, wo Fortschritt entsteht und wo Handlungsbedarf liegt.
5. Wo EBM oft missverstanden wird
EBM wirkt auf den ersten Blick schlicht. Gerade darin liegt seine Schwierigkeit. Viele Organisationen versuchen, EBM mit bestehenden Steuerungsinstrumenten zu verbinden – oft ohne Erfolg.
Häufige Missverständnisse sind:
- EBM sei ein Reporting-Tool.
- EBM sei ein Controlling-Mechanismus.
- EBM funktioniere nur in der IT.
EBM ist stattdessen ein Modell, das Klarheit schafft und Prioritäten transparent macht. Es unterstützt Entscheidungen, indem es den Blick auf Wirkung lenkt.
Ein zweites Zitat bringt diesen Gedanken gut auf den Punkt:
„Evidence ersetzt nicht Erfahrung. Evidence macht Erfahrung überprüfbar.“
Genau darin liegt die Stärke des Modells.
6. Warum EBM ein Fundament für modernen Wandel ist
In historisch gewachsenen Organisationen wird Veränderung selten linear erlebt. Entscheidungen werden abgestimmt, Positionen ausgeglichen, Risiken bewertet. Das schützt, aber es bremst auch.
EBM bietet einen Weg, Wandel greifbar zu machen:
- Es schafft Orientierung ohne starre Pläne.
- Es fördert Verantwortung, ohne Kontrolle zu überhöhen.
- Es verbindet Menschen über eine gemeinsame Sprache von Wert, Wirkung und Lernen.
In vielen Gesprächen erlebe ich, dass genau diese Verbindung fehlt. Teams arbeiten engagiert, Führungskräfte entscheiden sorgfältig – aber auf unterschiedlichen Grundlagen. EBM ist ein Weg, dieses Fundament zu schaffen.
Ein drittes Zitat beschreibt es so:
„Organisationen verändern sich nicht durch Tools, sondern durch Bewusstsein.“
EBM fördert genau dieses Bewusstsein.
7. Ausblick: Die vier Key Value Areas im Detail
Im nächsten Beitrag dieser Serie geht es um die vier Key Value Areas. Sie sind das Herzstück von Evidence-Based Management und helfen zu verstehen, warum Organisationen manchmal trotz großer Anstrengung kaum Fortschritte spüren.
Wir schauen uns an, wie jede KVA wirkt, wo sie häufig falsch interpretiert wird und wie sie helfen kann, Prioritäten neu zu setzen.
Weiterlesen in der Serie
Nächster Teil: Die vier Key Value Areas – was Organisationen oft falsch machen
Übersicht: Alle Teile der Serie „Agile Value Management“
- Teil 1: Evidence-Based Management als Brücke zwischen Scrum und Management – aktuell hier
- Teil 2: Die vier Key Value Areas – was Organisationen oft falsch machen
- Teil 3: Warum viele Teams KPIs falsch verstehen – eine Fehlerkultur
- Teil 4: OKR richtig verstehen – warum OKRs erst mit EBM funktionieren
- Teil 5: OKR in der Non-Profit- und Verbandswelt
- Teil 6: Moderne KPIs – was wirklich gemessen werden muss
- Teil 7: KPIs ohne Modell – warum KPI-Listen oft scheitern
- Teil 8: EBM × OKR × KPI – das integrierte Modell für modernes Management




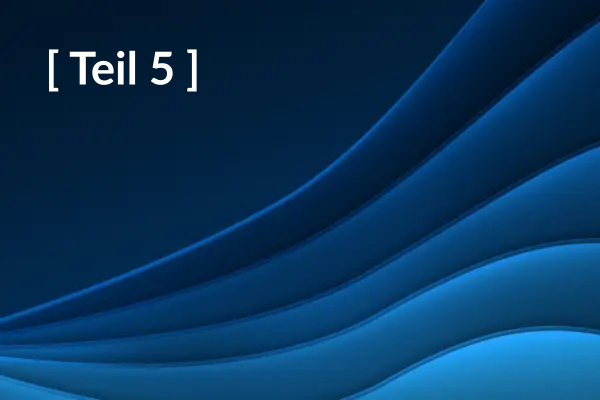
Comments