Die vier Key Value Areas – was Organisationen oft falsch machen
Viele Organisationen suchen Orientierung im Wandel – besonders, wenn Strukturen historisch gewachsen sind und zahlreiche Interessen miteinander verwoben sind. Evidence-Based Management schlägt hier kein neues Framework vor, sondern eine gemeinsame Denkstruktur. Die vier Key Value Areas (KVA) sind der Kern dieser Struktur. Sie schaffen Klarheit darüber, wo Wert entsteht, wo Potenziale liegen und was Veränderung verhindert.
Die KVA stammen aus dem offiziellen Evidence-Based Management Guide von Scrum.org scrum.org/resources/online-evidence-based-management-guide und sind bewusst einfach formuliert. Die Herausforderung liegt nicht in der Theorie, sondern in der Anwendung.
„Komplexität verschwindet nicht, wenn man sie ignoriert – aber sie wird handhabbar, wenn man sie strukturiert betrachtet.“
1. Current Value – Wie viel Nutzen schaffen wir heute?
Current Value beschreibt die Wirkung, die ein Produkt, ein Angebot oder eine Organisation im Hier und Jetzt entfaltet. Es geht nicht um Umsatz oder Aktivität, sondern um Nutzen: für Kundinnen, Klienten, Mitglieder oder Mitarbeitende.
Typische Fehlinterpretationen:
- Current Value wird mit Zufriedenheit verwechselt.
- Es werden interne Kennzahlen gemessen, obwohl externe Wirkung zählt.
- In Verbänden: Fokus auf interne Abläufe statt auf Nutzereffekte.
Beispiel aus der Sozialwirtschaft: Ein Verband misst, wie viele Dokumente digitalisiert wurden – nicht aber, ob Klientinnen tatsächlich schneller Zugang zu Leistungen erhalten.
Current Value lädt dazu ein, die Frage zu stellen: Was kommt wirklich bei Menschen an?
2. Unrealized Value – Welches Potenzial bleibt ungenutzt?
Unrealized Value zeigt die Lücke zwischen dem Wert von heute und dem Wert, der möglich wäre. Er beschreibt, wie viel „Zukunft“ im Produkt steckt.
Fehlinterpretationen:
- Unrealized Value wird mit Vision verwechselt.
- Es wird zu abstrakt gedacht („Innovation“ statt messbarer Potenziale).
- Potenzial wird über das eigene Bauchgefühl definiert, nicht über Beobachtung.
Beispiel: Viele Organisationen wissen, dass ihre digitalen Angebote wenig genutzt werden. Unrealized Value fragt hier nicht nach Schuld, sondern nach Potenzial: Wo wäre Wirkung möglich, wenn Barrieren sinken?
Unrealized Value ist besonders wertvoll in Bereichen, die wenig Wettbewerb haben – Verbände, Verwaltungen, Non-Profit-Organisationen. Er zeigt, dass Stillstand nicht gleich Zufriedenheit bedeutet.
„Potenzial ist kein Versprechen – es ist eine Einladung, genauer hinzusehen.“
3. Ability to Innovate – Was hindert uns, besser zu werden?
Ability to Innovate beschreibt die Fähigkeit einer Organisation, wirksam Veränderungen vorzunehmen. Sie ist oft die am meisten unterschätzte KVA.
Typische Hindernisse:
- überfrachtete Prozesse
- technische Altlasten
- fehlende Entscheidungsspielräume
- Wissen, das an Einzelpersonen hängt
- komplexe Gremienstrukturen
Gerade historisch gewachsene Organisationen spüren diese Barrieren täglich. Ability to Innovate fragt nicht nach Schuld, sondern zeigt systemisch auf, was Veränderung bremst.
Beispiel aus einem Verband: Ein neues digitales Tool ist möglich, aber Entscheidungen müssen durch fünf Ausschüsse. Das verringert nicht die Kompetenz, aber die Fähigkeit, Innovationen tatsächlich umzusetzen.
4. Time-to-Market – Wie schnell können wir lernen?
Time-to-Market ist keine Wettbewerbskennzahl, sondern eine Lernkennzahl. Sie beschreibt, wie schnell eine Organisation Ideen, Verbesserungen oder Entlastungen umsetzen kann – unabhängig davon, ob sie gewinnorientiert ist.
Fehlinterpretationen:
- Time-to-Market wird als Geschwindigkeit verstanden.
- Es wird gemessen, wie „schnell“ Teams arbeiten – statt wie schnell Ergebnisse ankommen.
- Organisationen glauben, Beschleunigung sei immer gut.
Beispiel: Ein Sozialverband führt ein neues Formular ein. Technisch dauert die Umsetzung drei Tage, organisatorisch aber sechs Monate. Das zeigt nicht mangelnde Leistung, sondern strukturelle Verzögerungspunkte.
Time-to-Market macht sichtbar, wo Lernen möglich ist und wo Strukturen es verhindern.
5. Warum die KVA oft missverstanden werden
Drei Muster tauchen besonders häufig auf:
- KVA werden wie KPIs behandelt – als Zahlen, nicht als Perspektiven.
- Organisationen wählen zu viele Messwerte und verlieren Orientierung.
- Die KVA werden als isolierte Bereiche betrachtet, obwohl sie zusammengehören.
Die KVA sind nicht dafür gedacht, Komplexität zu vereinfachen. Sie helfen, sie zu sortieren.
„Die KVA sind keine Antworten. Sie sind gute Fragen.“
6. Wie man die KVA sinnvoll messbar macht
Messbarkeit bedeutet nicht, perfekte Daten zu haben. Es bedeutet, gemeinsam zu beobachten:
- Welche Signale zeigen echten Fortschritt?
- Wo entstehen Rückmeldungen aus der Nutzung?
- Welche Daten liegen bereits vor, ohne neue Systeme zu schaffen?
- Welche wenigen Metriken erzeugen wirklich Erkenntnis?
Besonders wirksam ist es, pro KVA nur ein bis zwei Indikatoren zu wählen – und sie regelmäßig gemeinsam zu reflektieren.
7. Warum die KVA Orientierung geben – gerade im Wandel
Organisationen, die im Wandel stehen, müssen Entscheidungen nicht schneller, sondern klarer treffen. KVA bieten dafür einen Orientierungsrahmen, der sowohl Führung als auch Teams einschließt.
Sie helfen:
- Prioritäten zu setzen
- Evidenz über Meinung zu stellen
- Wirkung sichtbar zu machen
- Lernprozesse zu fördern
In föderalen, demokratisch strukturierten Organisationen ermöglichen die KVA eine gemeinsame Sprache – ohne Kontrolle, aber mit Klarheit.
Ausblick: Wie EBM die Fehlerkultur rund um KPIs verändert
Der nächste Beitrag setzt genau hier an: Warum KPIs so oft in die Irre führen und wie Evidence-Based Management eine lernorientierte Fehlerkultur fördert.
- Key Value Areas (KVA) – Vier Perspektiven auf Wert und Fortschritt - CV, UV, A2I und T2M.
- Current Value (CV) – Wirkung, die ein Produkt oder eine Organisation heute bereits entfaltet.
- Unrealized Value (UV) – Noch ungenutztes Potenzial und zukünftiger möglicher Wert.
- Ability to Innovate (A2I) – Fähigkeit einer Organisation, sinnvolle Veränderungen tatsächlich umzusetzen.
- Time-to-Market (T2M) – Zeitspanne, bis eine erste spürbare Verbesserung beim Menschen ankommt.
Weiterlesen in der Serie
Nächster Teil: Warum viele Teams KPIs falsch verstehen – eine Fehlerkultur
Übersicht: Alle Teile der Serie „Agile Value Management“
- Teil 1: Evidence-Based Management als Brücke zwischen Scrum und Management
- Teil 2: Die vier Key Value Areas – was Organisationen oft falsch machen – aktuell hier
- Teil 3: Warum viele Teams KPIs falsch verstehen – eine Fehlerkultur
- Teil 4: OKR richtig verstehen – warum OKRs erst mit EBM funktionieren
- Teil 5: OKR in der Non-Profit- und Verbandswelt
- Teil 6: Moderne KPIs – was wirklich gemessen werden muss
- Teil 7: KPIs ohne Modell – warum KPI-Listen oft scheitern
- Teil 8: EBM × OKR × KPI – das integrierte Modell für modernes Management




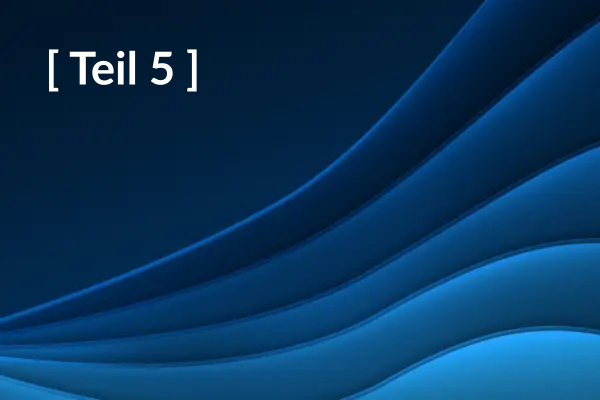
Comments