Warum viele Teams KPIs falsch verstehen – eine Frage der Fehlerkultur
Kaum eine Organisation arbeitet heute ohne Kennzahlen. Es gibt Dashboards, Berichte, Ampeln und Scorecards. Zahlen scheinen Klarheit zu versprechen, besonders in der digitalen Transformation. Doch in vielen Teams entsteht ein gegenteiliger Effekt: KPIs erhöhen den Druck, ohne Orientierung zu schaffen. Es wird gemessen, ohne wirklich zu verstehen, was die Zahlen bedeuten und wie sie Entscheidungen verändern sollen.
Evidence-Based Management bietet hier einen anderen Blick. Es stellt nicht die Kennzahl in den Mittelpunkt, sondern die Frage, welchen Wert eine Veränderung für Menschen erzeugt. KPIs werden in diesem Verständnis nicht abgeschafft, sondern neu verortet: als Werkzeuge im Dienst von Lernen und Entwicklung.
In diesem Beitrag geht es darum, warum KPIs in vielen Organisationen schaden statt helfen, welche typischen Messfehler auftreten und wie eine andere Fehlerkultur rund um Kennzahlen aussehen kann.
1. Fünf häufige Messfehler in Organisationen
In Gesprächen mit Teams tauchen bestimmte Muster immer wieder auf. Sie sind unabhängig von Branche oder Größe erstaunlich ähnlich.
1. Vanity Metrics – Kennzahlen, die gut aussehen, aber nichts verändern
Vanity Metrics sind Kennzahlen, die in Präsentationen beeindruckend wirken, aber kaum helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Beispiele sind reine Zugriffszahlen, Follower-Zahlen oder die Anzahl von gesendeten Mails, wenn diese Werte nicht mit einem erkennbaren Ziel verknüpft sind.
Eine Organisation kann steigende Zugriffszahlen auf ihrer Website feiern und gleichzeitig erleben, dass sich an der tatsächlichen Nutzung von Angeboten nichts verändert. Die Zahl ist hoch, aber ohne Kontext bleibt sie leer.
2. Output statt Outcome – Aktivität wird mit Wirkung verwechselt
Ein sehr verbreitetes Muster: Es werden Kennzahlen rund um Aktivität gemessen, etwa Anzahl abgeschlossener Tickets, Zahl der Schulungen, Dauer von Meetings. All das kann sinnvoll sein, solange klar ist, wofür diese Aktivität steht.
Problematisch wird es, wenn Aktivität als Erfolg gewertet wird, ohne auf die Wirkung zu schauen. Ein Team kann viele Aufgaben erledigen und gleichzeitig an den Bedürfnissen von Nutzerinnen und Nutzern vorbeiarbeiten.
3. Kennzahlen ohne Bezug zu einem Modell
Viele KPI-Systeme wachsen historisch. Hier eine Kennzahl aus einem Bericht, dort eine Zahl aus einem Tool. Nach und nach entsteht eine Sammlung von Messgrößen, die kaum noch miteinander verbunden sind.
Fehlt ein Modell dahinter – wie etwa die vier Key Value Areas von Evidence-Based Management – entsteht eine Art Kennzahlenteppich: breit ausgerollt, aber schwer zu begehen. Führung und Teams verlieren den Überblick, welche Zahlen wirklich relevant sind und welche nur aus Gewohnheit mitlaufen.
4. Verwechslung von Korrelation und Kausalität
Ein weiteres Muster: Es werden Zusammenhänge gesehen, wo keine sind. Steigt eine Kennzahl und sinkt gleichzeitig eine andere, wird häufig ein kausaler Zusammenhang hergestellt, ohne dass es dafür eine belastbare Grundlage gibt.
Beispiel: Der Rückgang von Supportanfragen wird direkt als Erfolg eines neuen Tools gedeutet. Tatsächlich könnte er aber genauso gut auf verändertes Nutzerverhalten oder Barrieren im Zugang zurückgehen. Ohne Beobachtung und Rückkopplung bleibt die Kennzahl eine Vermutung.
5. Kennzahlen als Kontrollinstrument statt als Einladung zum Gespräch
Vielleicht der kritischste Punkt: KPIs werden eingesetzt, um Kontrolle zu sichern, statt um Lernräume zu eröffnen. Zahlen werden dann genutzt, um Leistung zu bewerten oder Druck auszuüben.
Das verändert die Haltung im Umgang mit Daten. Teams optimieren ihr Verhalten auf die Kennzahl, nicht auf den Wert dahinter. Fehler werden versteckt, statt sichtbar gemacht. Lernen wird blockiert.
Ein Satz bringt das Problem auf den Punkt:
„Wenn Kennzahlen vor allem Angst auslösen, hört Lernen auf.“
2. Warum KPIs in vielen Organisationen mehr schaden als helfen
Kennzahlen an sich sind nicht das Problem. Sie werden dann zum Risiko, wenn sie losgelöst von Wert, Kontext und Haltung betrachtet werden.
Drei Effekte sind besonders sichtbar:
-
Kennzahlen erzeugen scheinbare Sicherheit Es fühlt sich beruhigend an, Zahlen vor sich zu haben. Sie vermitteln das Gefühl, alles im Griff zu haben. Doch wenn diese Zahlen nicht sauber eingeordnet werden, entsteht eine trügerische Sicherheit.
-
Kennzahlen verdecken Unterschiede in der Perspektive Führung, Teams und Stakeholder interpretieren dieselben Zahlen oft sehr unterschiedlich. Ohne gemeinsames Verständnis darüber, was gemessen wird und warum, verstärken KPIs Missverständnisse statt sie zu klären.
-
Kennzahlen verdrängen das Gespräch über Wert In vielen Runden werden Zahlen präsentiert, aber selten wird gefragt: Was bedeutet das eigentlich für die Menschen, für die wir arbeiten? Die Diskussion endet beim Diagramm, nicht bei der Wirkung.
Evidence-Based Management setzt an dieser Stelle an und stellt eine andere Frage: Welche wenigen Kennzahlen helfen uns, besser zu verstehen, wie sich Wert im Zeitverlauf entwickelt?
3. Wie Evidence-Based Management die Arbeit mit KPIs verändert
EBM definiert zunächst einen Rahmen, bevor es über Kennzahlen spricht. Mit den Key Value Areas – Current Value, Unrealized Value, Ability to Innovate und Time-to-Market – wird klar, worüber überhaupt gesprochen wird.
KPIs werden hier nicht als Ausgangspunkt, sondern als Ableitung verstanden. Sie dienen dazu, in jeder dieser Perspektiven Entwicklungen sichtbar zu machen.
Ein Beispiel:
- Current Value: Wie zufrieden sind Klientinnen mit der Erreichbarkeit eines Dienstes?
- Unrealized Value: Wie viele Menschen würden das Angebot nutzen, wenn Zugangsbarrieren sinken?
- Ability to Innovate: Wie viele Vorschläge aus dem Team werden tatsächlich ausprobiert?
- Time-to-Market: Wie lange dauert es von einer Idee bis zur ersten Umsetzung in einem realen Kontext?
In diesem Verständnis werden KPIs zu Beobachtungsinstrumenten. Sie unterstützen Fragen wie:
- Welche Veränderungen sehen wir im Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern?
- Wo bleiben Potenziale bisher ungenutzt?
- Was hindert uns daran, Verbesserungen auszuprobieren?
- Wie schnell kommen wir von der Entscheidung ins Handeln?
Eine zweite Formulierung, die diesen Unterschied beschreibt:
„Kennzahlen sind keine Urteile, sondern Hypothesen über die Wirklichkeit.“
4. Beispiele aus der Praxis: Wenn Kennzahlen wieder hilfreich werden
Einige typische Situationen zeigen, wie sich der Umgang mit KPIs verändern kann, wenn EBM als Rahmen genutzt wird.
Beispiel 1: Von Ticketzahlen zur wahrgenommenen Entlastung
Ein IT-Team in einer Sozialorganisation misst zunächst die Anzahl der erledigten Tickets. Die Zahl steigt, das Team wirkt ausgelastet. Doch die Wahrnehmung in der Organisation bleibt: Der Support sei überlastet und nicht ansprechbar.
Mit EBM wechselt der Fokus:
- Current Value: wahrgenommene Erreichbarkeit und Unterstützung
- Ability to Innovate: Zeitanteil, den das Team für Verbesserungen anstatt für reaktiven Support nutzen kann
Die Kennzahlen werden angepasst. Statt nur Ticketvolumen zu messen, wird systematisch Feedback zur Entlastung erhoben. Das Team gestaltet dadurch aktiv Maßnahmen, die langfristig weniger Störungen erzeugen. Kennzahlen werden zum Spiegel, nicht zum Druckinstrument.
Beispiel 2: Von Reichweite zu tatsächlicher Nutzung
Ein Verband freut sich über wachsende Reichweite seiner Online-Inhalte. Newsletter, Social-Media-Beiträge und Websitezugriffe steigen. Trotzdem bleiben Beratungstermine und konkrete Anfragen auf einem konstanten Niveau.
Mit dem Blick aus EBM-Perspektive wird klar:
- Current Value: tatsächliche Nutzung von Beratungsangeboten
- Unrealized Value: Menschen, die sich informieren, aber noch keinen Zugang finden
Die Organisation beginnt, gezielt zu messen, an welchen Punkten Interessierte abspringen. Kennzahlen werden genutzt, um Hürden zu erkennen und abzubauen. Die Frage verschiebt sich von „Wie viele Menschen sehen uns?“ hin zu „Wem konnten wir tatsächlich weiterhelfen?“.
Beispiel 3: Time-to-Market in der internen Digitalisierung
In einer föderalen Organisation werden viele digitale Projekte gleichzeitig angestoßen. Kennzahlen konzentrieren sich zunächst auf Budgettreue und Plantermine. Trotzdem zieht sich die Umsetzung in die Länge, Mitarbeitende empfinden Digitalisierung als zusätzliche Belastung.
EBM öffnet hier eine andere Perspektive:
- Time-to-Market: Wie lange dauert es, bis eine erste kleine Veränderung im Alltag erlebbar ist?
Die Organisation beginnt, gezielt kleine Teilverbesserungen zu planen und deren Zeit bis zur Nutzbarkeit zu messen. Bildlich gesprochen: lieber ein nutzbares kleines Stück jetzt, als ein großes System in zwei Jahren. Kennzahlen helfen so, Schritt für Schritt den Weg zu einer anderen Arbeitsweise zu finden.
5. Wie eine andere Fehlerkultur rund um KPIs aussehen kann
Eine lernorientierte Fehlerkultur im Umgang mit Kennzahlen bedeutet nicht, dass Ziele beliebig werden oder Verantwortung verschwimmt. Im Gegenteil: Sie setzt Klarheit voraus.
Drei Elemente sind zentral:
-
Kennzahlen werden gemeinsam verstanden Es ist transparent, warum eine Kennzahl existiert, was sie ausdrücken soll und welche Entscheidungen sie beeinflusst. Fragen sind ausdrücklich erwünscht.
-
Kennzahlen werden regelmäßig hinterfragt KPIs sind nicht statisch. Wenn sie keine Erkenntnisse mehr liefern, dürfen sie angepasst oder abgeschafft werden. Eine Kennzahl, die nichts mehr erklärt, blockiert.
-
Kennzahlen werden mit Beobachtung verbunden Zahlen werden nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenhang mit Erfahrungen, Feedback und konkreten Beispielen. So entsteht ein vollständigeres Bild.
Ein drittes Zitat beschreibt diese Haltung:
„Eine gute Kennzahl macht neugierig – sie beendet kein Gespräch, sie eröffnet eins.“
Evidence-Based Management unterstützt diese Art von Kultur. Statt Kennzahlen um ihrer selbst willen zu pflegen, werden sie zu Werkzeugen in einem fortlaufenden gemeinsamen Lernprozess.
Ausblick: OKR als Brücke zwischen Zielen und Evidenz
Im nächsten Beitrag der Serie geht es um Objectives and Key Results (OKR). Wir schauen uns an, warum OKRs oft als neues Heilsversprechen eingeführt werden, warum sie ohne Evidence-Based Management wenig bewirken und wie sie als Hypothesen über Wert verstanden werden können – statt als starre Vorgaben.
- KPI – Kennzahl, die eine relevante Veränderung sichtbar macht und Entscheidungen beeinflusst.
- Leading Indicator – Frühes Signal für mögliche Entwicklungen, das rechtzeitiges Handeln ermöglicht.
- Lagging Indicator – Rückblickende Kennzahl, die das Ergebnis vergangener Entwicklungen zeigt.
- Vanity Metric – Kennzahl, die gut aussieht, aber wenig über tatsächliche Wirkung aussagt.
Weiterlesen in der Serie
Nächster Teil: OKR richtig verstehen – warum OKRs erst mit EBM funktionieren
Übersicht: Alle Teile der Serie „Agile Value Management“
- Teil 1: Evidence-Based Management als Brücke zwischen Scrum und Management
- Teil 2: Die vier Key Value Areas – was Organisationen oft falsch machen
- Teil 3: Warum viele Teams KPIs falsch verstehen – eine Frage der Fehlerkultur – aktuell hier
- Teil 4: OKR richtig verstehen – warum OKRs erst mit EBM funktionieren
- Teil 5: OKR in der Non-Profit- und Verbandswelt
- Teil 6: Moderne KPIs – was wirklich gemessen werden muss
- Teil 7: KPIs ohne Modell – warum KPI-Listen oft scheitern
- Teil 8: EBM × OKR × KPI – das integrierte Modell für modernes Management




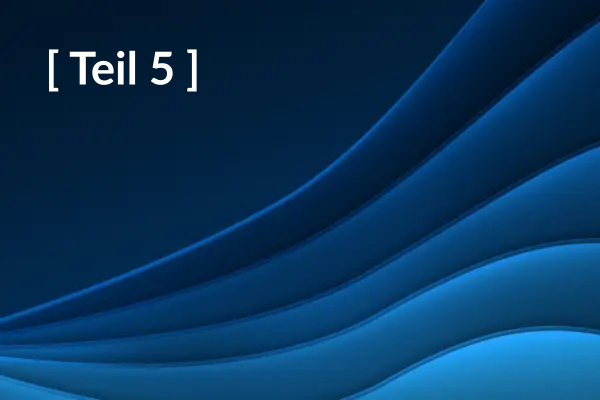
Comments