KPIs ohne Modell – warum KPI-Listen oft scheitern
Viele Organisationen arbeiten mit wachsendem Druck daran, ihre Leistungen messbar zu machen. Es entstehen umfangreiche KPI-Sammlungen, gefüllt mit Dutzenden von Kennzahlen aus verschiedenen Bereichen. Doch je größer diese Listen werden, desto seltener wird die zentrale Frage gestellt: Wofür steht diese Kennzahl eigentlich?
Eine KPI-Liste kann beeindruckend wirken. Sie suggeriert Überblick, Struktur und Kontrolle. Doch ohne klaren Rahmen entsteht oft das Gegenteil: Orientierungslosigkeit, Komplexität und Scheintransparenz. Menschen arbeiten an Zahlen, ohne zu verstehen, wie sie mit Wert zusammenhängen. Entscheidungen werden getroffen, ohne dass erkennbar ist, was sich für die Menschen verändert, für die man arbeitet.
Evidence-Based Management bietet hier eine notwendige Grundlage. Es strukturiert Messung entlang von Wert, Potenzial, Lernfähigkeit und Geschwindigkeit. Dadurch entsteht Orientierung, bevor Zahlen gesammelt werden.
1. Warum KPI-Listen ohne Modell nicht funktionieren
In vielen Organisationen entstehen KPI-Systeme historisch. Eine Kennzahl kommt aus Berichten, eine andere aus einem Tool, wieder eine dritte aus einer externen Anforderung. Stück für Stück entwickelt sich ein Flickenteppich.
Typische Symptome:
- Die Kennzahlen widersprechen sich.
- Niemand weiß genau, welche Zahl wie interpretiert werden soll.
- Berichte werden erstellt, aber kaum genutzt.
- Entscheidungen orientieren sich an Bauchgefühl statt an Beobachtung.
- Zahlen werden aus Gewohnheit weitergeführt, auch wenn sie nichts mehr erklären.
Ein Satz bringt dieses Muster gut auf den Punkt:
„Eine KPI-Liste ist keine Strategie.“
Kennzahlen haben nur dann Bedeutung, wenn sie Teil eines Modells sind, das erklärt, wie Wert entsteht und wie man ihn beobachtet.
2. Das Anti-Pattern: KPI-Sammlung statt Erkenntnis
Das häufigste Muster ist die Sammlung von Zahlen ohne erkennbaren Zusammenhang. Einige Beispiele:
- Im Reporting stehen Zufriedenheitswerte neben Bearbeitungszeiten, obwohl beide nichts miteinander zu tun haben.
- Ein Team misst Meetings, ein anderes Aufwände, ein drittes Nutzerzahlen.
- Die Geschäftsführung sieht sich jede Woche ein Dashboard an, das keine Fragen beantwortet.
Solche KPI-Systeme erzeugen Aktivität, aber keine Erkenntnis. Es entsteht eine Art „Messroutine“, die selten zu besseren Entscheidungen führt. Teams sind beschäftigt, aber nicht orientiert.
3. Warum Kennzahlen ohne Narrative nicht wirken
Kennzahlen brauchen ein Narrativ, also eine gemeinsame Erzählung darüber, wie Wert entsteht und wie Fortschritt aussieht. Ohne dieses Narrativ werden Zahlen zu isolierten Beobachtungen, die jeder anders deutet.
Beispiel: Eine steigende Zahl von Supportanfragen kann ein Zeichen für Erfolg sein (mehr Nutzung) – oder für Probleme (mehr Hürden). Ohne Kontext lässt sich das nicht entscheiden.
Ein zweiter Satz fasst die Schwierigkeit zusammen:
„Eine Zahl erklärt nichts – sie zeigt nur, wo man genauer hinsehen muss.“
Kennzahlen ohne Modell laden zu Fehlinterpretationen ein. Sie werden zum Auslöser für Diskussionen über Zuständigkeiten oder Bewertungen, statt zum Ausgangspunkt von Lernen.
4. Wie Evidence-Based Management Klarheit schafft
Evidence-Based Management strukturiert KPIs entlang der vier Key Value Areas:
- Current Value
- Unrealized Value
- Ability to Innovate
- Time-to-Market
Erst diese Struktur erzeugt Orientierung. Denn sie beantwortet die grundlegenden Fragen:
- Was wirkt heute?
- Was wäre möglich?
- Was hindert uns daran?
- Wie schnell lernen wir?
Innerhalb dieses Rahmens lassen sich KPIs sinnvoll zuordnen. Die Kennzahl wird dann nicht isoliert betrachtet, sondern eingebettet in ein Verständnis von Wert und Weiterentwicklung.
Beispiel: Eine sinkende Nutzerzahl kann im Kontext von CV, UV, A2I und T2M sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Durch die Einordnung entsteht ein gemeinsames Bild.
5. Wie ein gesundes KPI-System entsteht
Ein funktionierendes KPI-System entsteht nicht durch mehr Daten, sondern durch bewusstes Weglassen. Ein sinnvoller Ansatz:
- Pro KVA ein oder zwei Kernindikatoren wählen
- Diese Kennzahlen regelmäßig gemeinsam reflektieren
- Zahlen abschaffen, die nichts mehr erklären
- Keine Kennzahl nutzen, die nicht mit einer Frage verbunden ist
- Narrativ und Zahlen zusammen betrachten
Besonders wirksam ist der Grundsatz: weniger, aber klarer.
6. Beispiele: Wenn KPIs wieder sinnvoll werden
Beispiel 1: Digitale Anträge
Statt:
- Anzahl eingegangener Formulare
- Anzahl der Formulare mit Fehlern
- Anzahl der Rückfragen
wird beobachtet:
- Anteil der Personen, die den Prozess ohne Unterstützung abschließen konnten
- beobachtete Abbruchstellen
- wahrgenommene Verständlichkeit
Beispiel 2: Interne Arbeit
Statt:
- Anzahl der Meetings
- Bearbeitungsdauer pro Ticket
wird beobachtet:
- Zeit bis zur ersten Umsetzung nach einer Entscheidung
- wahrgenommene Klarheit über Verantwortlichkeiten
Beispiel 3: Ehrenamt
Statt:
- Anzahl der Ehrenamtlichen
- Anzahl der Schulungen
wird beobachtet:
- wahrgenommene Wirksamkeit der Unterstützung
- Hürden bei der Nutzung digitaler Tools
Ein dritter Satz beschreibt die Essenz:
„Kennzahlen werden wertvoll, wenn sie Teil eines Gesprächs über Wirkung werden.“
Ausblick: Das integrierte Modell – EBM × OKR × KPI
Der letzte Teil der Serie fasst die bisherigen Perspektiven zusammen. Es entsteht ein integriertes Modell, das Wert, Ziele und Messung miteinander verbindet – als Grundlage moderner Organisationsführung.
- kpi-system (nicht gefunden)
- Vanity Metric – Kennzahl, die gut aussieht, aber wenig über tatsächliche Wirkung aussagt.
- Leading Indicator – Frühes Signal für mögliche Entwicklungen, das rechtzeitiges Handeln ermöglicht.
- Lagging Indicator – Rückblickende Kennzahl, die das Ergebnis vergangener Entwicklungen zeigt.
Weiterlesen in der Serie
Nächster Teil: EBM × OKR × KPI – das integrierte Modell für modernes Management
Übersicht: Alle Teile der Serie „Agile Value Management“
- Teil 1: Evidence-Based Management als Brücke zwischen Scrum und Management
- Teil 2: Die vier Key Value Areas – was Organisationen oft falsch machen
- Teil 3: Warum viele Teams KPIs falsch verstehen – eine Frage der Fehlerkultur
- Teil 4: OKR richtig verstehen – warum OKRs erst mit EBM funktionieren
- Teil 5: OKR in der Non-Profit- und Verbandswelt
- Teil 6: Moderne KPIs – was wirklich gemessen werden muss
- Teil 7: KPIs ohne Modell – warum KPI-Listen oft scheitern – aktuell hier
- Teil 8: EBM × OKR × KPI – das integrierte Modell für modernes Management



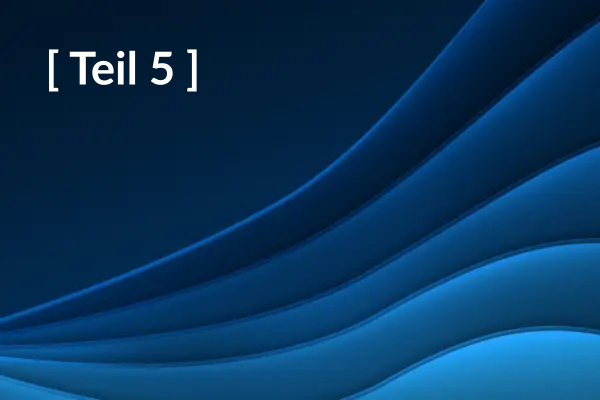
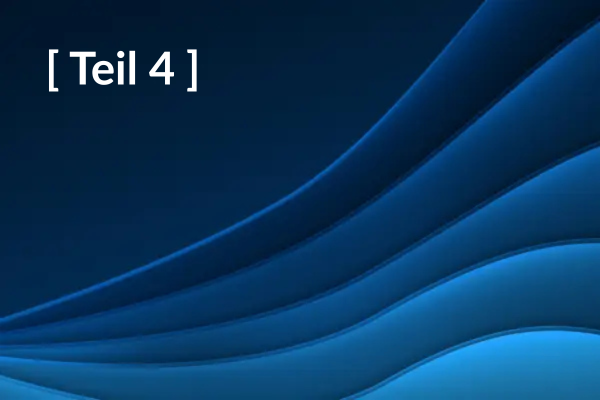
Comments