OKR richtig verstehen – warum OKRs erst mit EBM funktionieren
OKR gilt heute als eines der modernsten Zielsysteme. Viele Organisationen führen es ein, um Klarheit zu schaffen, Prioritäten sichtbar zu machen oder Teams mehr Selbstorganisation zu ermöglichen. Doch die Realität zeigt ein anderes Bild: OKR wird oft missverstanden, falsch angewendet oder verliert sich in Detaildiskussionen. Statt Orientierung entsteht Verunsicherung.
In diesem Beitrag geht es darum, wie OKR gedacht ist, warum es ohne Evidence-Based Management kaum Wirkung entfaltet und wie ein Zielsystem aussieht, das tatsächlich Lernen ermöglicht.
1. OKR – ein Zielsystem, kein Planungswerkzeug
OKR steht für Objectives and Key Results.
- Ein Objective beschreibt eine Richtung, ein lohnendes Zielbild.
- Key Results beschreiben, woran sich beobachten lässt, ob sich etwas in Richtung dieses Ziels bewegt.
OKR ist damit ein Zielsystem, das sich bewusst von klassischen Plänen unterscheidet. Es geht nicht darum, Aktivitäten festzulegen, sondern Wirkung sichtbar zu machen.
Ein Satz fasst diesen Unterschied gut zusammen:
„OKRs beschreiben nicht, was wir tun wollen, sondern was wir verändern wollen.“
Damit lädt OKR zu Reflexion ein: Welche Wirkung soll entstehen? Was bedeutet Fortschritt? Warum lohnt sich dieses Ziel?
In vielen Organisationen geht dieser Gedanke jedoch verloren. OKR wird als To-do-Liste missverstanden oder als präziser Projektplan. Das erzeugt Frust und nimmt dem System seine Kraft.
2. Warum OKRs in vielen Organisationen scheitern
Drei Muster sind besonders häufig sichtbar:
1. OKR ohne Bezug zu Wert
Viele Objectives werden formuliert, ohne dass klar ist, welchen Wert sie erzeugen sollen. Das Ziel bleibt vage, die Key Results wirken künstlich konstruiert.
Beispiel: „Wir steigern unsere Sichtbarkeit.“ Doch für wen? Warum? Und woran wird dieser Fortschritt erkennbar?
2. OKR als starre Zielvorgabe
In manchen Organisationen wird OKR wie ein Vertrag behandelt, den Teams erfüllen müssen. Statt lernorientiert Entscheidungen zu treffen, wird das Erreichen der Key Results zum Selbstzweck.
3. OKR ohne Hypothese
Oft wird nicht darüber gesprochen, welche Annahmen hinter den Key Results stehen. Warum sollte dieses Ergebnis überhaupt Wirkung entfalten? Welche Unsicherheit steckt darin?
Ohne diese Reflexion bleibt OKR eine weitere Zielmethode – jedoch ohne Substanz.
3. Wie Evidence-Based Management OKR erst wirksam macht
OKR und EBM ergänzen sich, weil sie unterschiedliche Aufgaben erfüllen:
- Evidence-Based Management beschreibt Wert, Potenzial und Lernfähigkeit einer Organisation.
- OKR beschreibt, wie sich dieses Potenzial in konkrete Ziele übersetzen lässt.
EBM schafft die Grundlage, um gute Fragen zu stellen: Was ist heute wertvoll? Wo liegt ungenutztes Potenzial? Was hindert uns daran, besser zu werden? Welche Veränderungen würden Menschen tatsächlich spüren?
OKR wird dadurch nicht nur ein Zielsystem, sondern ein Hypothesen-System. Jede Formulierung ist eine Annahme darüber, wie Wert entsteht.
Ein zweiter Satz bringt diesen Gedanken auf den Punkt:
„OKR ist erst dann wirksam, wenn jedes Key Result eine überprüfbare Hypothese über Wert ist.“
Damit verschiebt sich auch die Art, wie Organisationen mit Zielen umgehen. OKR ersetzt nicht die Strategie. Es operationalisiert sie – als lernorientierter Prozess.
4. Objectives als Richtung, nicht als Kontrolle
Ein gutes Objective hat drei Eigenschaften:
- Es beschreibt eine Bedeutung, nicht eine Aufgabe.
- Es ist so formuliert, dass Menschen sich damit verbinden können.
- Es ist offen genug, um unterschiedliche Wege zu ermöglichen.
Objectives sind kein Werkzeug der Kontrolle, sondern der Orientierung. Sie geben eine Richtung vor und erlauben gleichzeitig, innerhalb dieser Richtung zu lernen.
Beispiel aus der Sozialwirtschaft: „Wir erleichtern Klientinnen den Zugang zu unseren digitalen Dienstleistungen.“ Hier zeigt sich klar die Wirkung, nicht die Aktivität.
5. Key Results als Beobachtungen von Veränderung
Key Results sind nicht die Maßnahmen. Sie beschreiben, woran erkennbar wird, dass Wirkung entsteht.
Wichtige Eigenschaften:
- messbar oder zumindest beobachtbar
- nicht manipulativ
- eng am Nutzerverhalten
- Ergebnis, nicht Aktivität
Beispiel zum Objective oben:
- Anteil der Personen, die ihren Antrag ohne Unterstützung digital abschließen konnten
- Rückgang der Abbrüche bei digitalen Formularen
- wahrgenommene Einfachheit in der Nutzung
Diese Key Results beschreiben Veränderungen, die Menschen erleben – nicht die interne Aktivität.
Ein drittes Zitat fasst diese Haltung zusammen:
„Ein Key Result ist dann gut, wenn es ein Gespräch auslöst.“
6. Warum OKR eine Haltung erfordert
OKR funktioniert nur, wenn Organisationen bereit sind:
- Unsicherheit zu akzeptieren
- Ziele laufend anzupassen
- Ergebnisse offen zu reflektieren
- Teams Autonomie im Wie zu geben
- Key Results als Lernsignale zu sehen, nicht als Leistungsbewertung
Das ist besonders herausfordernd in Organisationen, die historisch stark strukturiert sind oder viele Entscheidungsebenen haben. OKR kann dort jedoch helfen, Orientierung zu schaffen, ohne in starren Planungslogiken zu verharren.
7. OKR und demokratische Strukturen – ein besonderer Zusammenhang
Verbände, Sozialorganisationen und föderale Strukturen arbeiten oft mit sehr unterschiedlichen Perspektiven und Interessenlagen. OKR kann hier helfen, diese Vielfalt konstruktiv zu bündeln.
Denn OKR lädt zu drei Dingen ein:
- Klarheit über gemeinsame Ziele
- Transparenz über die Annahmen dahinter
- Raum für lokale Interpretationen und Lösungen
Gerade in demokratischen Systemen, die viele Stimmen zusammenbringen, bietet OKR eine Sprache, die sowohl Orientierung als auch Autonomie ermöglicht.
Ausblick: OKR in der Non-Profit- und Verbandswelt
Der nächste Beitrag geht genau auf diese Besonderheiten ein. Wir schauen uns an, wie OKR in föderalen Organisationen wirken kann, welche Stolperfallen typisch sind und wie Ziele formuliert werden, die sowohl realistisch als auch inspirierend sind.
- Objective – Verständliche, sinnstiftende Zielrichtung, die Wirkung beschreibt statt Maßnahmen.
- Key Result – Beobachtbare Veränderung, die zeigt, ob ein Objective erreicht wird.
- OKR-Zyklus – Rhythmus, in dem Ziele definiert, verfolgt und reflektiert werden.
- Outcome-Hypothese – Annahme darüber, warum ein Ziel überhaupt Wirkung erzeugen sollte.
Weiterlesen in der Serie
Nächster Teil: OKR in der Non-Profit- und Verbandswelt
Übersicht: Alle Teile der Serie „Agile Value Management“
- Teil 1: Evidence-Based Management als Brücke zwischen Scrum und Management
- Teil 2: Die vier Key Value Areas – was Organisationen oft falsch machen
- Teil 3: Warum viele Teams KPIs falsch verstehen – eine Frage der Fehlerkultur
- Teil 4: OKR richtig verstehen – warum OKRs erst mit EBM funktionieren – aktuell hier
- Teil 5: OKR in der Non-Profit- und Verbandswelt
- Teil 6: Moderne KPIs – was wirklich gemessen werden muss
- Teil 7: KPIs ohne Modell – warum KPI-Listen oft scheitern
- Teil 8: EBM × OKR × KPI – das integrierte Modell für modernes Management




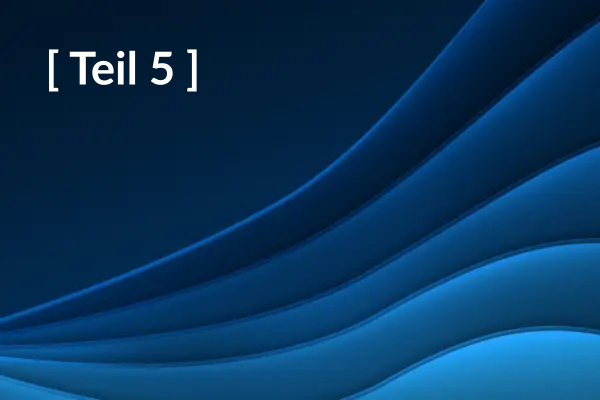
Comments