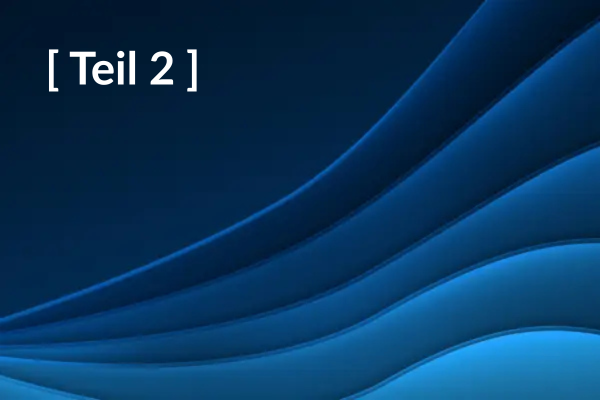Evidence-Based Management – Kernkonzepte
Diese Glossarseite bündelt die wichtigsten Begriffe aus dem Evidence-Based Management (EBM). Sie dient als Referenz für alle Blogposts der Serie „Agile Value Management“ und erklärt, wie moderne Organisationen Wert erkennen, Potenziale sichtbar machen und Barrieren für Fortschritt verstehen.
EBM ist bewusst einfach formuliert. Die Herausforderung liegt nicht im Verstehen der Begriffe, sondern in ihrer konsequenten Anwendung im Alltag — vor allem in Organisationen, die viele Perspektiven vereinen oder historisch gewachsene Strukturen mit sich bringen.
Evidence-Based Management (EBM)
Evidence-Based Management ist ein Entscheidungsmodell, das Organisationen dabei hilft, Wert, Lernen und Fortschritt sichtbar zu machen. EBM verbindet Empirie mit Orientierung: Entscheidungen entstehen nicht auf Basis von Tradition oder Bauchgefühl, sondern anhand von Beobachtung, Wirkung und kontinuierlicher Verbesserung. Es ergänzt agile Arbeitsweisen und erweitert Scrum auf die Ebene der Organisation.
Im Kern strukturiert EBM drei Dimensionen: Wert, Potenzial und Lernfähigkeit. Dadurch hilft es Organisationen, zu erkennen, wo sie heute stehen, was möglich wäre und was Veränderung verhindert. Besonders in Non-Profit- oder Verbandssystemen ermöglicht EBM, komplexe Realitäten zu sortieren und Entscheidungen nachvollziehbarer zu machen.
Key Value Areas (KVA)
Die Key Value Areas sind das Herzstück von EBM. Sie beschreiben vier Perspektiven, durch die Wert und Fortschritt beobachtbar werden: Current Value, Unrealized Value, Ability to Innovate und Time-to-Market. KVA sind keine Kennzahlen, sondern Fragen, die Orientierung schaffen und Diskussionen strukturieren.
Die KVA sind besonders hilfreich, wenn Organisationen über Prioritäten sprechen müssen. Sie verhindern, dass Entscheidungen rein auf Vermutungen oder persönlichen Präferenzen beruhen. Durch die gemeinsame Struktur entsteht ein klarer Rahmen, der Teams und Führung hilft, Veränderungen besser einzuordnen und zu messen.
Current Value (CV)
Current Value beschreibt die Wirkung, die eine Organisation oder ein Produkt heute entfaltet. Es geht darum, wie gut der aktuelle Zustand den Bedarf der Menschen erfüllt, die die Leistungen nutzen. Dabei stehen Wahrnehmung, Nutzbarkeit und Erfüllung im Vordergrund — nicht interne Abläufe oder Prozesse.
Für Organisationen ist Current Value eine Möglichkeit, das Hier und Jetzt besser zu verstehen: Was funktioniert gut? Wo entsteht bereits Nutzen? Wo laufen Menschen in Hürden? CV richtet den Blick auf das, was heute real wirkt — und schafft damit die Grundlage für Verbesserungen, ohne vorschnell in Aktionismus zu verfallen.
Unrealized Value (UV)
Unrealized Value beschreibt das Potenzial, das eine Organisation noch nicht nutzt. Es zeigt, wie groß der Wert sein könnte, wenn bestimmte Barrieren überwunden oder ungenutzte Möglichkeiten ausgeschöpft würden. UV richtet den Blick nach vorne und macht sichtbar, welche Entwicklungen realistische Chancen bieten.
In der Praxis hilft UV, Zukunftschancen zu erkennen, ohne ins Spekulative abzurutschen. Der Blick bleibt an den Bedürfnissen und Verhaltensmustern der Menschen orientiert. Besonders in Organisationen ohne klassischen Wettbewerb — etwa Verbänden oder Non-Profit-Strukturen — macht UV sichtbar, dass „kein Problem“ nicht automatisch „kein Potenzial“ bedeutet.
Ability to Innovate (A2I)
Ability to Innovate beschreibt die Fähigkeit einer Organisation, sinnvolle Veränderungen tatsächlich umzusetzen. A2I ist damit kein Kreativbegriff, sondern ein Hinweis auf strukturelle Barrieren: technische Altlasten, fehlende Entscheidungsfreiräume, überfrachtete Abstimmungsprozesse oder Wissen, das an Einzelpersonen hängt.
A2I hilft Organisationen zu erkennen, dass nicht Motivation oder Kompetenz das Problem sind, sondern Rahmenbedingungen. Es zeigt, wo Veränderung ausgebremst wird und welche Hebel nötig wären, um Verbesserungen schneller erfahrbar zu machen. Diese Perspektive ist für viele Teams erleichternd, weil sie Verantwortung verteilt und nicht individualisiert.
Time-to-Market (T2M)
Time-to-Market beschreibt, wie schnell eine Organisation lernen und Verbesserungen sichtbar machen kann. Dabei geht es nicht um Geschwindigkeit im Sinne von Effizienz, sondern um die Zeit, die zwischen einer Entscheidung und einer ersten spürbaren Verbesserung vergeht.
T2M ist besonders wertvoll, wenn Organisationen häufig in großen, langwierigen Projekten denken. Es hilft, Fortschritt kleinteiliger zu gestalten und die Wirkung schneller erlebbar zu machen. Diese Perspektive unterstützt eine Kultur, in der kleine Schritte wertvoll sind — und in der Lernen regelmäßig und systematisch stattfindet.